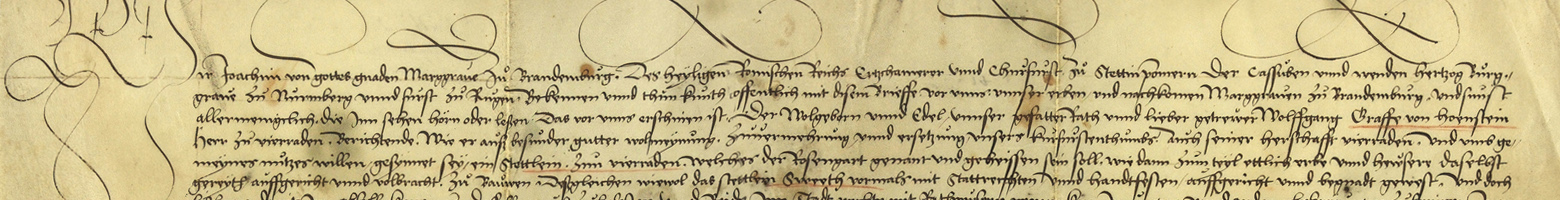Schlösser und Herrenhäuser in der deutsch-polnischen Grenzregion (Archiv)

Vom 24. April bis zum 29. Juni 2018 zeigt die Stadt Schwedt/Oder die Ausstellung „Schlösserlandschaften in der deutsch-polnischen Grenzregion“ im Schwedter Rathaus.
Was ist das Besondere daran? Die heutige Grenzregion von Polen und Deutschland – mit den Wojewodschaften Westpommern, Lebuser Land und Niederschlesien sowie den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen – ist von einer jahrhundertelangen Geschichte geprägt. Zeugnisse dafür sind u. a. bedeutende Schlossanlagen und Herrenhäuser. Verbunden damit sind in der Regel Park- und Gartenanlagen sowie ein besonderer Kulturlandschaftstyp. Die zu den Schlössern und Herrenhäusern gehörenden Wirtschaftshöfe bildeten die ökonomische Grundlage zur Erhaltung der adligen und großbürgerlichen Anwesen. Schlösser und Herrenhäuser waren Zentren der örtlichen Kultur und Träger der jeweiligen regionalen Identität.

Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs befanden sich fast alle Anlagen in Privatbesitz. Die traditionelle Nutzung trug entscheidend zur Erhaltung des Bestandes bei. Neben unmittelbaren Kriegsschäden kam es 1945 und danach im gesamten Grenzraum zu Plünderungen sowie zu Flucht und Vertreibung der angestammten Besitzer und Bewohner. Soweit sie erhalten blieben, dienten die Gebäude, zumeist in der Nachkriegszeit, als Notunterkunft für Flüchtlinge.
Mit den neuen kommunistischen Nachkriegsregierungen in Polen und der DDR kamen ideologisch motivierte Zerstörungen hinzu. In der DDR wurden die Besitzer der Anlagen pauschal als Mitschuldige für den Nationalsozialismus angesehen und deshalb enteignet und vertrieben. Etliche Guts- und Herrenhäuser wurden abgebrochen. Dem stand allerdings die Wohnungsnot der Bevölkerung und vor allem der vielen Flüchtlinge aus dem Osten entgegen. Häufig wurden die verstaatlichten Herrenhäuser als Kindergärten, Einrichtungen der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften oder für Arztpraxen genutzt – sowie für Gemeindeverwaltungen und Kulturhäuser. Auf diese Weise wurden zwar viele Gebäude erhalten, Umbauten und weiterer Verschleiß führten aber oft zu starken Veränderungen. Die Gartenanlagen verwilderten oder wurden nicht selten parzelliert. Nur wenige Schlösser und Herrenhäuser konnten ihrer Bedeutung entsprechend kulturell oder museal genutzt werden.
In den östlichen, nun polnischen Gebieten herrschte eine ähnliche Situation. Hier kam noch hinzu, dass durch die Verschiebung der deutsch-polnischen Grenze nach Westen an Oder und Neiße sowie die Zwangsumsiedlung der polnischen Bevölkerung in die neuen Westgebiete die lokale Tradition und Identität nicht nur ideologisch, sondern auch menschlich gebrochen wurde. Stattdessen bildeten sich neue Identitätsmuster, die die Geschichte des neu besiedelten Ortes und damit auch der Herrenhäuser nicht mehr einbezogen. Während z. B. die einst protestantischen Kirchengebäude für den katholischen Gottesdienst weiter genutzt wurden, fehlte bei den meisten Herrenhäusern eine Nutzung, so dass sie verfielen.

Der gemeinsame kulturelle Raum beiderseits von Oder und Neiße war ab 1945 bis mindestens 1989 durch die neue Staatsgrenze zerschnitten. Auf beiden Seiten der Neiße gab es kaum eine Möglichkeit, aber auch nicht die ökonomische Kraft, die Herrenhäuser mit ihren Park- und Gartenanlagen dauerhaft im Gesamtzusammenhang zu erhalten.
Nach 1989 wurden in Polen die im staatlichen Besitz befindlichen Anlagen privatisiert. Es entstanden Freizeit- und Erholungsorte, Hotels und Konferenzzentren. Einige Anlagen dienen auch wieder als private Wohnanlagen. Die hohen Kosten bei der Sanierung und der Refinanzierungsdruck der eingesetzten privaten Gelder führten oft zu Konflikten mit dem konservatorischen Interesse der Erhaltung von bauzeitlicher Substanz. Schwierig war es auch, die historischen Gesamtzusammenhänge wieder erlebbar zu machen.
Insgesamt ist die Situation beiderseits von Oder und Neiße heute durchaus ähnlich. Allerdings zeigen sich die Problemlagen regional unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt inzwischen eine Vielzahl von positiven denkmalgerechten Sanierungsbeispielen, auch im privaten Sektor. Dem gegenüber stehen noch zahlreiche Anlagen ohne Nutzung. Die Erhaltung des noch immer reichhaltigen Schloss- und Herrenhausbestandes als wichtiger Teil einer europäischen Kulturlandschaft stellt nicht nur die Denkmalpflege vor erhebliche Herausforderungen.
Die Ausstellung verdeutlicht anhand von vier Kategorien – denkmalfachlich gelungene neue Nutzung, denkmalverträgliche Teilnutzung, erfolgreiche und solide Sicherung und Gefahr für die Bauwerke – den reichen Bestand sowohl in Westpommern, im Lebuser Land und in Niederschlesien als auch in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen. Gleichzeitig soll sie die Öffentlichkeit für diesen Teil der historischen Baukultur sensibilisieren und die derzeitigen Zustände verdeutlichen.
Da es sich bei den Schlössern und Herrenhäusern um ein gemeinsames Erbe handelt, sind auch gemeinsame Strategien zur Erhaltung zu entwickeln.
Zur Ausstellung gibt es einen kostenfreien Katalog (deutsch-polnisch), der im Stadtarchiv erhältlich ist. Führungen durch die Ausstellung sind mittwochs nach Voranmeldung im Stadtarchiv (Telefon 03332 446-791) möglich.